Fühlst du dich manchmal wie in einem kompletten Widerspruch gefangen? In deiner Brust schlagen zwei Herzen: In einem Moment genießt du die Ruhe und den Fokus im stillen Kämmerlein, im nächsten stehst du voller Energie im Austausch mit anderen und könntest stundenlang reden. Als Extrovertierter stundenlang fokussiert und still? Als Introvertierte gesprächig im Austausch? Lange hatte ich selbst keinen Begriff für dieses Gefühl, in keine der gängigen Schubladen – „introvertiert“ oder „extrovertiert“ – so richtig zu passen.
Denn die Business‑Welt scheint oft nur diese beiden Rollen zu kennen: den lauten Vordenker und den stillen Experten im Hintergrund. Wenn du dich – wie ich und sehr, sehr viele andere Menschen – in diesem Dazwischen wiederfindest, dann besitzt du vielleicht die flexibelste und wirkungsvollste Eigenschaft im modernen Business: Ambiversion – sprich: du bist ambivertiert.
Mein bisher wichtigstes Buch kannst du jetzt bei Amazon bestellen! Die „Journalisten-Methode“ ist ein einfaches und leicht im Arbeitsalltag anzuwendendes System, mit dem ich mich in Zeiten von KI-Content-Einheitsbrei behaupte und relevant bleibe – und das kannst du auch!

Bitte keine Schubladen mehr: Warum die Mitte die Norm ist
Wenn du schweigsam bist, nennen sie dich schüchtern und introvertiert. Wenn du redselig und zugänglich bist, sagen sie, du seist ein Quatschkopf. Ja, auf welcher Seite stehe ich denn nun? Möglicherweise auf keiner. Denn niemand erzählt dir, dass es tausend Facetten zwischen den Extremen gibt. Die Gesellschaft liebt einfache Kategorien: Du bist entweder das eine oder das andere. Aber die Realität ist keine Entweder‑oder‑Frage, sondern eine Skala. Die meisten Menschen befinden sich nicht an den Rändern, sondern irgendwo dazwischen. Wenn du dich dort wiederfindest, bist du ambivertiert. Es gibt kein direkt Synonym dafür, nur eine Umschreibung: Du bist sowohl introvertiert als auch extrovertiert
Für mich war die Entdeckung dieses Begriffs ein absoluter Aha‑Moment. Plötzlich hatte das, was ich längst gefühlt habe, einen Namen. Die Phasen, in denen ich am liebsten wochenlang allein an einem Buch schreibe, sind genauso ein Teil von mir wie die Momente, in denen ich auf Veranstaltungen mühelos mit Menschen ins Gespräch komme. Das ist keine Unentschlossenheit oder ein Mangel an Persönlichkeit. Das ist eine Stärke. Vorher war es eine ständige Verwirrung: Warum kann ich heute vor Energie sprühen und morgen das Bedürfnis haben, mich vor der Welt zu verstecken? Die Erkenntnis, dass beides normal ist, war eine Befreiung für mich.
Die Psychologie bestätigt diese Sichtweise seit Langem. Der Begriff „ambivert“ wurde bereits 1923 vom Psychologen Edmund S. Conklin eingeführt. Moderne Modelle wie die „Big Five“ der Persönlichkeitsforschung betrachten Extraversion als Kontinuum, auf dem jeder Mensch seinen Platz hat. Die Extreme bekommen die meiste Aufmerksamkeit, weil unser Gehirn auf das Auffällige getrimmt ist – das Laute und das extrem Leise. Die ausbalancierte, flexible Mitte, in der sich viele befinden, wird dabei oft übersehen.

Verständnis entwickeln: Ambiversion jenseits von Schubladen
Ambiversion bedeutet nicht „weder noch“, sondern „sowohl als auch“: ein beweglicher Punkt auf der Skala zwischen Intro‑ und Extraversion. Die Psychologie versteht Extraversion heute als Kontinuum statt als starre Typenlehre. Das erklärt, warum sich viele situativ mal still, mal gesellig erleben – ohne Widerspruch. Der Begriff „Ambivert“ taucht wie gesagt bereits 1923 bei Edmund S. Conklin auf. Er ergänzt die moderne Sicht auf Persönlichkeit als Dimension und macht sie alltagstauglich: ein präziser Name für etwas, das viele längst spüren und für das sie keinen Namen haben.
Für die Praxis heißt das: Du bist kein Mensch, der immer gleich reagieren muss. Du hast zwei gesunde Modi – Präsenz im Raum und Tiefe am Schreibtisch – und darfst beide situativ wählen. Oder manchmal wählen sie dich. Das ist nicht Opportunismus, sondern Professionalität. Ambiversion ist mehr als Balance – sie ist ein Wettbewerbsvorteil für alle, die in wechselnden Rollen bestehen: als Führungskraft, Solo‑Selbstständige:r, Creator oder Teammitglied.
Warum die Mitte unsichtbar bleibt – und dir das schadet
Extreme dominieren die Wahrnehmung. In Social Media wie im Meeting zieht Lautstärke die Aufmerksamkeit auf sich, während solide, leise Substanz schnell als „selbstverständlich“ durchrutscht. Das verführt zu zwei teuren Reaktionen: Entweder passt du dich einem Extrem an und verbrennst Energie. Oder du ziehst dich zu weit zurück und wirst übergangen. Ambiversion ernst zu nehmen heißt, den Lautstärke‑Regler bewusst zu bedienen. Nicht auf „laut“ oder „leise“ klemmen, sondern dosiert spielen – so, wie es dem Ziel der Situation dient.
Ein zweiter Grund für die Unsichtbarkeit der Mitte: Viele Organisationen und Kunden belohnen Sendeleistung kurzfristig stärker als Ergebnisqualität. Wer redet, wirkt aktiv. Wer denkt, liefert später – und oft besser. Ambiverts haben hier einen Vorteil: Sie werden sichtbar, wenn es zählt, und verschwinden, wenn es der Sache dient. Das ist keine Tarnung, sondern saubere Energie‑ und Aufmerksamkeitsführung. In einer Welt, die „Lautstärke mit Kompetenz“ verwechselt, ist die Fähigkeit, bewusst zu steuern, Gold wert.
Wer sich nicht auf ein Extrem festlegt, kann wechselweise beide Rollen glaubwürdig einnehmen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil: Menschen erleben dich als flexibel, aber nicht beliebig. Als verbindlich, aber nicht starr. Genau dieser Eindruck schafft Vertrauen – und Vertrauen ist die eigentliche Währung im Business.
Praktische & wertvolle Ratgeber in meinem Shop unter shop.saschategtmeyer.com!
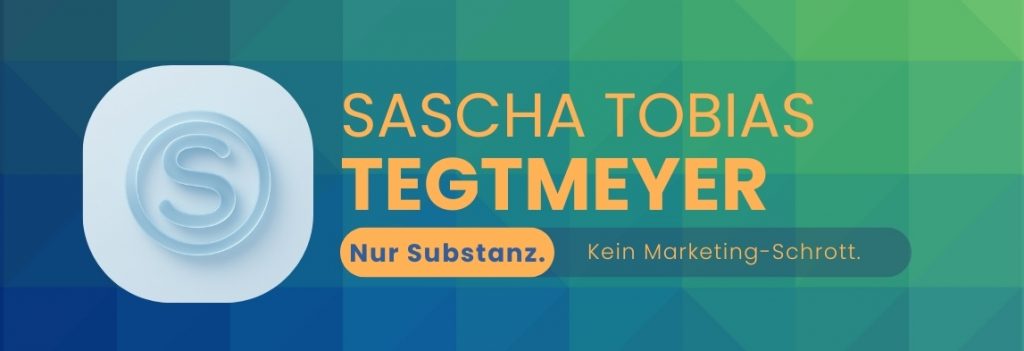
Hast du etwas zu sagen? Möchtest du dein Produkt & deine Expertise dem idealen Publikum zeigen? Egal, ob privat oder für dein Unternehmen – die Threads App ist ein Booster für deine Reichweite! Die ultimative Starter-Checkliste für den schnellen Einstieg – jetzt kostenlos sichern!
Meine tägliche Praxis zwischen Recherche‑Funk und Schreib‑Tiefe
Wenn ich ein komplexes Thema bearbeite, gehe ich offensiv auf Menschen zu – per E‑Mail‑Interview, einem kurzen, fokussierten Call oder vor Ort. Ich frage präzise, höre aufmerksam zu, sichere Zitate und Fakten. Danach wechsle ich in den zweiten Modus: Türen zu, Telefon still, Fenster auf Fokus. Ich sortiere, verdichte, schreibe. Ohne beide Modi wäre das Ergebnis halb so stark: Ich würde die Stimmen nicht einfangen, wenn ich mich hinter dem Bildschirm verstecke. Und ich bekäme die Nuancen nicht sauber auf die Seite, wenn ich nur quatsche.
In Redaktionsmeetings entscheide ich bewusst: Bringt ein Beitrag jetzt Fortschritt? Dann formuliere ich klar, knapp, entscheidungsorientiert. Wenn nicht, halte ich mich zurück, notiere offene Punkte und kläre sie asynchron. Ambiversion ist hier kein „Mittelweg“, sondern eine präzise Wahl: Wirkung statt Geräuschkulisse.
Pitches? Ich kenne die Falle. Hohe Energie, gutes Storylining – und beim Gegenüber kippt es plötzlich in „zu viel“. Meine Gegenmaßnahme ist simpel: erst spiegeln (Ziel, Kontext, Constraints), dann die Lösung in drei Sätzen, erst danach Dynamik erhöhen. So bleibt Führung im Gespräch, ohne zu überwältigen. Ambiversion ist hier ein Regelpult, kein Kippschalter.
Hochsensibilität und die richtige Dosis
Viele Ambiverts berichten von schneller Überstimulation: Geräusche, Gerüche, Menschenmengen. Hochsensibilität (SPS) erklärt das gut – ist aber kein Synonym für Introversion. Ein Teil der Hochsensiblen ist extravertiert. Das passt zur Erfahrung: gern unter Menschen, aber in der richtigen Dosis. Entscheidend ist nicht, ob du „es aushältst“, sondern ob du deiner Arbeit und deinem Nervensystem gerecht wirst. Für mich heißt das: Nach drei Stunden Geselligkeit folgt ein Reset‑Fenster. Kein Screen, frische Luft, stilles Notieren. Danach ist die Batterie wieder benutzbar – für die Arbeit, nicht für die nächste Plauderrunde.
In einer lauten, schnellen Arbeitswelt ist diese Selbststeuerung überlebenswichtig. Ambiverts und Hochsensible verhindern so, dass sie ausbrennen. Stattdessen setzen sie bewusste Kontrapunkte: aussteigen, fokussiert pausieren, Energie aktiv zurückholen. Unspektakulär – und langfristig enorm wirksam.

Energie‑Budget statt Zeitplan
Zeitpläne allein lösen das Ambiversions‑Dilemma nicht. Es geht um Energietypen. Kommunikation und tiefe Arbeit ziehen aus unterschiedlichen Reserven. Wenn du sie mischst, verlierst du beides: Klarheit im Gespräch und Tiefe im Text. Plane deshalb soziale Peaks und Fokusfenster getrennt. Nutze den Apple‑Fokus bzw. den Nicht‑stören‑Modus, schalte Benachrichtigungen aus und entscheide bewusst, wann das Netz offen ist. Gerade wenn Transkriptionen serverbasiert laufen, sind „Online‑Fenster“ sinnvoller als Remote‑Dauerfeuer. Der Qualitätsunterschied ist spürbar.
Das fühlt sich anfangs streng an, wird dann befreiend. Du musst weniger „nein“ sagen, weil du klare „wann“ hast. Kunden bemerken das als Souveränität. Teams als Verlässlichkeit. Und du selbst als Konzentrationsgewinn. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um ein System, das Energievergeudung ausschließt – die Basis für dauerhaft gute Arbeit.
Ambivertiertes Netzwerken: leise magnetisch
Ich habe kein Talent für Smalltalk‑Marathons – und brauche keins. Ich liebe tiefgründige Gespräche und freue mich über jede derartige Konversation zu jeder Zeit – auch überraschend. Ambivertiertes Netzwerken ist asynchron, inhaltsgeführt und dokumentiert. Die Threads App eignet sich für kurze, ehrliche Denkanstöße, die Resonanz erzeugen, ohne die Batterie zu leeren. LinkedIn ist nützlich für präzise Kommentare und klare Argumente. E‑Mail‑Interviews liefern Tiefe, Zitate und ein schriftliches Fundament. So ziehst du die Richtigen an, statt dich durch Events zu schleifen, die dich auslaugen. Sichtbarkeit entsteht aus Substanz plus Rhythmus – nicht aus Lautstärke.
Mein Leitbild lautet ziehen statt drängen. Zeig, wie du denkst. Dokumentiere, was du lernst. Mach Angebote, die den nächsten klaren Schritt ermöglichen. Wer dich kennenlernen will, kommt auf dich zu. Du musst nicht in jeder Ecke stehen und dich aufblasen. Deine Gedanken sind dein Magnet.
Meetings: freundlich, klar, knapp
Meetings erzeugen oft Wärme und wenig Licht. Als Ambivert entscheidest du vorab, welche Rolle du übernimmst. Muss hier eine Entscheidung fallen? Gibt es echte Risiken zu benennen? Kann ich eine Unklarheit auflösen? Wenn ja, nach vorne. Wenn nein, halte den Raum sauber, ohne ihn zu füllen. Das ist kein Rückzug, sondern Dienst am Ergebnis. Ein kurzer Nachsatz per E‑Mail oder Kommentar, der konkret weiterführt, schlägt zehn Minuten „noch ein Punkt von mir“.
Wenn du im Meeting ruhig bleibst, erwarten viele stillen Konsens. Formuliere dann aktiv, was du später asynchron prüfen willst. So vermeidest du den Klassiker „Wir dachten, du hättest nichts dagegen“ – und schützt dein Energie‑Budget. Schweigen wird vom Stolperdraht zur Methode: Zeichen von Achtsamkeit, nicht von Zustimmung.

Meine Lieblingsmethode: Mit ersten Prinzipien von Null her denken
Wenn du ein Problem nach ersten Prinzipien auflöst, nimmst du ihm nicht nur seinen Schrecken, sondern machst es handelbar und kannst bessere Entscheidungen treffen. Schau dir beispielhaft an, wie einfach es ist, übertragen auf das bisher gesagte. Gegeben: zwei wertvolle Modi – sozial wirksam und tief fokussiert. Ziel: mehr wirksame Outputs (Entscheidungen, Inhalte, Ergebnisse) bei gleicher oder geringerer Erschöpfung. Drei Hebel folgen daraus. Erstens die Energietrennwand: keine Gleichzeitigkeit von Output‑Arten. Reden und Schreiben sind zwei verschiedene Sportarten. Wer beides parallel betreibt, verliert an Technik. Zweitens die Kanalauswahl: asynchron vor synchron. Dokumentation vor flüchtigem Gespräch. Schriftliches zwingt zu Klarheit und produziert Wiederverwendbares. Drittens die Dosissteuerung: soziale Peaks als geplante Sprints statt als Dauerlauf. Wer permanent sendet, hat keine Reichweite mehr, wenn es zählt.
So verschiebt sich die Frage nach einer Analyse nach ersten Prinzipien ganz automatisch von „Bin ich intro‑ oder extravertiert?“ zu „Welchen Modus braucht die Aufgabe – und wann?“. Das ist handwerklich statt identitär – und deshalb lösbar. So gewinnst du Klarheit.
Mentale Modelle, die tragen
Drei Denkwerkzeuge bewähren sich für den Alltag als Ambivertierter besonders. Der OODA‑Loop – Observe, Orient, Decide, Act – ordnet Gespräche wie Texte: erst beobachten und verorten, dann entscheiden und handeln. Der Pareto‑Blick erinnert daran, dass ein kleiner Teil der Gespräche den Großteil der Klarheit liefert. Identifiziere diese 20 Prozent und investiere dort. Und der Expected‑Value‑Ansatz hilft bei der Kanalauswahl: Wähle die Kommunikationsform mit dem höchsten Erwartungswert für Klarheit pro eingesetzter Energie. Für mich ist das in der Regel das E‑Mail‑Interview vor „kurz mal telefonieren“, weil ich die Ergebnisse dann direkt schwarz auf weiß hab und direkt weiterverwenden kann. Diese Modelle vermeiden Fehler und schaffen Reproduzierbarkeit – im Business unbezahlbar.
Anti‑Zerdenk‑Werkzeuge – unspektakulär, aber effektiv
Wenn dir ein Kontakt schwerfällt, setze einen Fünf‑Minuten‑Timer, bereite die erste Nachricht vor und schicke sie ab. Erwarte nicht sofort Erfolg; erwarte, dass du am nächsten Tag leichter schreibst. Lege eine Standard‑Option fest: Standard ist asynchron. Nur wenn der Abstimmungsaufwand größer wird als ein kurzer Call, hebst du auf synchron. Prüfe Entscheidungen auf Umkehrbarkeit. Wenn sie leicht rückgängig zu machen sind, wähle Tempo vor Perfektion. Setze Timeboxes für soziale Aktivitäten: Es ist in Ordnung, klar zu sagen, dass du jetzt den nächsten Block startest. Das ist keine Unhöflichkeit, sondern Hygiene.
Typische Fehler – und wie du sie vermeidest
Der häufigste Denkfehler ist das Entweder‑oder‑Selbstbild. Du bist nicht fest verdrahtet. Erlaube dir, den Regler zu bewegen – begründet durch das Ziel der Aufgabe. Zweitens der Meeting‑Sog: viele Worte, wenig Wirkung. Lege Rede‑Trigger fest: Du sprichst, wenn du eine Entscheidung voranbringst, ein Risiko benennst oder eine Unklarheit klärst. Drittens die Abneigung gegen Sichtbarkeit: „Ich will nicht laut sein.“ Musst du nicht. Authentische Präsenz heißt, Probleme sichtbar zu lösen – nicht dich. Viertens das Ignorieren von Überreizung: Plane Erholung wie einen Termin. Professionalität, kein Luxus. Fünftens die Illusion, alles gleichzeitig bedienen zu müssen: Multitasking zerstört Ambiversion. Stärke entsteht im Wechsel, nicht im Dauerfeuer.
Ein Wochenrhythmus, der funktioniert
So sieht eine Woche aus, wenn Ambiversion bewusst gesteuert wird. Montag bis Donnerstag gibt es je zwei tiefe Fokusblöcke und zwei Kommunikationsfenster. Der Tag beginnt mit Klarheit: Welche Entscheidung, welcher Text, welches Ergebnis hat Priorität? Gesprächsanfragen landen im asynchronen Kanal und werden in den Fenstern gesammelt beantwortet. Wenn ein synchrones Gespräch nötig ist, liegt es zwischen den Fokusblöcken – nie mitten hinein. Nach dichten sozialen Phasen folgt ein kurzer Reset: zehn bis dreißig Minuten ohne Screen, ein paar Notizen, frische Luft. Freitag ist Review‑Tag: Was hat Wirkung erzeugt, was hat nur Energie gekostet? Daraus entsteht der Plan für die nächste Woche. Nicht spektakulär, aber stabil – und genau das braucht Substanz.
Die Regel ist kein Korsett, sondern ein Sicherheitsnetz. Wer Montag bis Donnerstag strukturiert, darf am Wochenende experimentieren. Wer klare Blöcke setzt, kann flexibel verschieben, wenn es die Situation erfordert. Ambiversion verlangt kein starres System – sondern eines, das bewusst elastisch ist.

FAQs – kurz und knapp beantwortet
Was heißt „ambivertiert im Business“ konkret?
Es bedeutet, dass du aktiv zwischen Präsenz in Gespräch und Meeting sowie tiefer Arbeit in Ruhe wechselst – nicht zufällig, sondern geplant. Beide Modi sind gleichwertig und dienen dem Ergebnis.
Bin ich ambivertiert oder einfach schüchtern?
Schüchternheit ist eine situationsbezogene Hemmung. Ambiversion beschreibt deine Position auf der Extraversion‑Skala. Du kannst schüchtern sein und ambivert – oder nicht. Entscheidend ist, wie du deine Dosis steuerst und welche Aufgaben du damit besser löst.
Hat die Mitte wirklich Vorteile?
In Kontexten wie Vertrieb zeigen Daten, dass der Mittelbereich oft am besten performt: genug Durchsetzungsfähigkeit, kombiniert mit echtem Zuhören. Das lässt sich sauber in Gesprächsführung, Moderation und Kundenarbeit übersetzen.
Ist Hochsensibilität dasselbe wie Introversion?
Nein. Hochsensibilität ist ein eigener Zug und nur teilweise mit Introversion verknüpft. Es gibt extravertierte Hochsensible. Das erklärt, warum du gern unter Menschen bist – aber eben nicht endlos.
Wie netzwerke ich, ohne mich zu verstellen?
Asynchron und inhaltsgeführt. Teile kleine, klare Gedanken, kommentiere präzise, führe E‑Mail‑Interviews. Dokumentation schlägt Dauer‑Smalltalk. Qualität vor Quantität: Ein wertvoller Kontakt pro Woche bringt mehr als zehn oberflächliche Gespräche.
Wie lade ich meine „soziale Batterie“?
Kurz raus, kein Screen, Gedanken notieren. Plane diese Reset‑Fenster proaktiv – besonders nach intensiven Gesprächen. Danach arbeitest du wieder, statt zu scrollen. Wer die eigene Batterie kennt und achtet, bleibt auf Dauer stabil – fachlich und menschlich.
Starte kostenlos mit meinen nützlichen Einsteigerkursen!
- Immer die passenden Worte finden und ausdruckstärker sprechen lernen in nur 5 Minuten täglich!
- Kinderleicht Interessenten gewinnen – die Threads App als Booster für deine Social-Media-Reichweite nutzen!
- Herausstechen und überzeugen – Mit der Journalisten-Methode gegen den KI-Content-Müll angehen!
- Deep Work für Selbstständige – mit Sprache und KI Produktivität verdoppeln und Arbeitszeit halbieren!
Fazit – die Stärke der Ambiversion
Ambiversion ist kein Kompromiss, sondern eine doppelte Stärke. Du kannst Klarheit schaffen – im Raum und auf der Seite. Wenn du deine Modi aktiv planst, wird aus Zerren eine Choreografie: soziale Sprints, tiefe Arbeit, sichtbare Ergebnisse. Das ist Souveränität, nicht Lautstärke. Und genau das schafft Vertrauen – bei Kund:innen, Leser:innen und Teams. Mehr noch: Es macht dich resilient. In einer Welt, die Extreme belohnt, aber die Mitte braucht, bist du das Scharnier. Und Scharniere halten Systeme zusammen.

