Du planst vier Wochen für ein Projekt – und am Ende werden es acht. Nicht, weil du schlecht arbeitest, sondern weil dein Kopf eine bequeme Abkürzung nimmt: Er sieht Start und Ziel, aber übersieht den steinigen Weg dazwischen. Dieser Planungsfehler kostet Zeit, Geld – und Selbstvertrauen. Vor allem gewissenhafte Fachleute trifft das, weil Zuverlässigkeit Teil ihrer Identität ist.
Die gute Nachricht: Du musst nicht härter arbeiten, sondern klüger planen. In diesem Beitrag bekommst du eine verständliche, praxistaugliche Vorgehensweise – ohne Fachchinesisch. Du lernst, wie du Bandbreiten statt Wunschzahlen nutzt, wie du mit einer einfachen Vorab‑Fehleranalyse blinde Flecken sichtbar machst und wie du mit klarer Sprache Erwartungen steuerst. Seitdem ich vor einigen Jahren das Buch „Schnelles denken, langsames Denken“ von Daniel Kahneman gelesen habe, setze ich mich bereits intensiv mit Denkfehlern auseinander. Insgesamt gibt es über 100 davon, die wir Menschen privat und im Business täglich machen. Der Planungsfehler ist einer, den ich früher am häufigsten gemacht habe – und gelernt habe, ihn zu reduzieren.
Mein bisher wichtigstes Buch kannst du jetzt bei Amazon bestellen! Die „Journalisten-Methode“ ist ein einfaches und leicht im Arbeitsalltag anzuwendendes System, mit dem ich mich in Zeiten von KI-Content-Einheitsbrei behaupte und relevant bleibe – und das kannst du auch!

Was hinter dem Planungsfehler steckt
Wir unterschätzen Aufwand, Zeit und Risiken und überschätzen den Nutzen. Der Grund ist die Innenperspektive: Wir schauen aus unserer eigenen Vorstellung auf das Projekt. In dieser Vorstellung läuft vieles glatt. Die Außenperspektive macht das Gegenteil: Sie fragt, wie lange vergleichbare Vorhaben tatsächlich gebraucht haben, wo es hakte und wie viele Korrekturen nötig waren. Dieser Blick erdet – und liefert realistische Bandbreiten statt einer Wunschzahl.
Wichtig: Erfahrung allein heilt den Denkfehler nicht. Viele unterschätzen ihn auch beim zehnten Mal noch. Unser Gehirn liebt einfache Geschichten und blendet Störungen aus. Das ist menschlich – nicht dumm. Entscheidend ist, dass du die Verzerrung sichtbar machst und deine Planung daran anpasst.
Wenn Planung und Wirklichkeit kollidieren
Beispiel aus meinem Alltag: Ein kurzer Ratgeber sollte in vier Wochen fertig sein. Am Ende wurden es acht. Kein einzelnes Desaster, sondern viele kleine Verzögerungen: zusätzliche Kapitel, Korrekturen, Layout, Freigaben. Dasselbe passiert bei Blogserien. „30 Beiträge in 30 Tagen“ klingt machbar – bis Anrufe, Kundenaufträge, Buchhaltung, Sport und Alltag dazwischenfunken. Die Realität hat Reibung.
Wenn klar wird, dass die Planung bröckelt, fühlt es sich persönlich an: heiß und kalt, Druck im Kopf, die innere Stimme: „Ich bin zu langsam. Ich reiche nicht.“ Hier beginnt professionelle Planung: Selbstrespekt statt Selbstvorwurf – und der Entschluss, den Denkfehler beim Namen zu nennen.
Warum gute Leute besonders gefährdet sind
Wer hohe Ansprüche hat, plant gerne ambitioniert. Wer viel kann, glaubt, er könne Reibung ausgleichen. Beides ist nachvollziehbar – und beides führt in die Falle. Qualität braucht Durchsichten, Entscheidungen brauchen Zuarbeiten, Kreativität braucht Pausen. Gute Arbeit ist nicht die schnellste, sondern die, die trotz Reibung zuverlässig fertig wird.

Viele kleine Gründe, große Wirkung
Projekte kippen selten wegen eines einzigen Fehlers. Meist summieren sich Kleinigkeiten: eine fehlende Info, eine Rückfrage, ein Termin, der sich um zwei Tage verschiebt, eine Entscheidung, die noch abgestimmt werden muss. Jede Unterbrechung für sich ist klein – zusammen kosten sie Wochen. Wer diese Reibungen ernst nimmt, plant automatisch in Bandbreiten.
Ein praktischer Blick hilft: Teile die Gesamtdauer gedanklich in drei Körbe – Arbeitszeit, Wartezeit, Nacharbeit durch Korrekturen. Viele planen nur die Arbeitszeit. Realistisch wird es erst, wenn die beiden anderen Körbe sichtbar werden. Dann schrumpft die Lücke zwischen Plan und Wirklichkeit.
Innen‑ gegenüber Außenperspektive – der blinde Fleck
In der Innenperspektive siehst du vom Start aus den Gipfel – aber nicht die Serpentinen, Geröllfelder und Wetterumschwünge. Die Außenperspektive zwingt dich, die Idealfantasie gegen Vergleichsdaten zu tauschen: Wie viele Durchsichten sind üblich? Welche Abhängigkeiten bremsen immer? Welche Engpässe wiederholen sich? Der Wechsel kann wehtun, macht Zusagen aber verlässlich.
So kommst du in die Außenperspektive
Führe ein kleines Logbuch. Nach jedem Projekt notierst du: geplante Dauer (z. B. deine 50‑Prozent‑Schätzung), tatsächliche Dauer, Anzahl der Durchsichten, größte Verzögerer. Nach wenigen Durchläufen siehst du Muster: Bildrechte brauchen fast immer länger. Zuarbeiten dauern oft eine Kalenderwoche. Entscheidungen verzögern sich regelmäßig um 48 Stunden. Aus diesen Notizen wird deine persönliche Referenzklasse – genauer als jede fremde Benchmark.
Ergänze drei einfache Kennzahlen: Durchlaufzeit (Start bis Abgabe), Anteil Wartezeit (Anteil ohne aktive Arbeit) und Korrekturquote (Stunden für Überarbeitungen im Verhältnis zur Erstfassung). Mit diesen drei Zahlen erkennst du, wo du hebeln kannst.
Praktische & wertvolle Ratgeber in meinem Shop unter shop.saschategtmeyer.com!
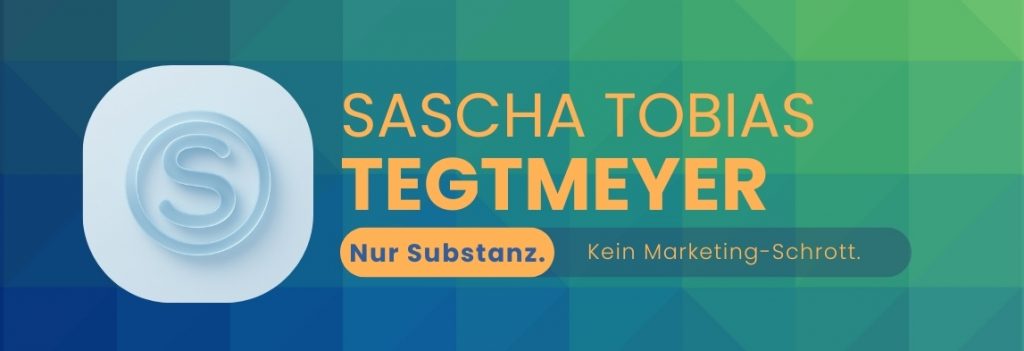
Hast du etwas zu sagen? Möchtest du dein Produkt & deine Expertise dem idealen Publikum zeigen? Egal, ob privat oder für dein Unternehmen – die Threads App ist ein Booster für deine Reichweite! Die ultimative Starter-Checkliste für den schnellen Einstieg – jetzt kostenlos sichern!
Drei Denkfehler, die alles schlimmer machen
Selbstüberschätzung: Gute Leute verwechseln Können mit Kontrollierbarkeit. Das führt zu Zusagen an der Grenze des Machbaren – ohne Reserve. Kommt dann nur eine Verzögerung dazu, fällt der Plan.
Optimismus‑Verzerrung: Wir halten den Idealfall für normal und Pech für die anderen. Wir rechnen mit pünktlichen Zuarbeiten, stabiler Technik, guter Tagesform. Realistisch ist: Ein Teil davon wackelt immer.
Versunkene Kosten: Weil du schon weit gegangen bist, gehst du weiter – obwohl ein Kurswechsel klüger wäre. Besser: Abbruch‑ und Kurswechsel‑Punkte vorab festlegen. Wenn Signal X eintritt, wird die Route angepasst. Das ist Disziplin, nicht Schwäche.
Gegenmittel sind keine Heldentaten, sondern klare Regeln und Abbruchpunkte – und die Bereitschaft, Bandbreiten offen zu kommunizieren.
Was ist eine Pre-Mortem-Analyse?
Ein Pre-Mortem ist ein „Scheitern-voraus“-Workshop. Bevor ein Projekt startet, tut ihr so, als wäre es in der Zukunft schiefgegangen – und sammelt alle plausiblen Gründe, warum. Aus den Top-Gründen leitet ihr Frühwarnzeichen und Gegenmaßnahmen ab. Das reduziert Wunschdenken und macht Pläne robuster.
Der Gegenplan: Haltung, Methode, Kommunikation
Das Ziel der Haltung ist Schadensbegrenzung, nicht Perfektion. Entkopple deinen Selbstwert vom Tempo. Gute Planung misst sich an guten Entscheidungen – nicht an schönen Wunschzahlen.
Nutze Methoden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Vor jedem größeren Vorhaben eine kurze Vorab‑Fehleranalyse: Stell dir vor, das Projekt ist zu spät oder gescheitert. Sammle die wahrscheinlichsten Gründe. Übersetze die wichtigsten Punkte in konkrete Frühwarnzeichen („Woran merken wir, dass X eintritt?“) und erste Schritte.
Danach schätzt du in Bandbreiten: nicht eine Zahl, sondern drei – optimistisch, realistisch, pessimistisch. Aus diesen Werten ergibt sich ein realistischer Mittelwert und – wichtiger – eine Spanne. Termine sind Wahrscheinlichkeiten, keine Eide. Intern arbeitest du mit der 50‑Prozent‑Schätzung, nach außen kommunizierst du die 80‑Prozent‑Schätzung. Das ist erwachsen und fair.
Entscheidend ist zudem die Kommunikation. Mit Kunden und anderen Beteiligten entkoppelst du Ziel, Umfang und Zeit. Du bietest Optionen statt Scheinpräzision: kleinerer Umfang früher – oder voller Umfang später. So schützt du die Qualität und vermeidest stille Enttäuschungen.

Ein Wochenplan, der trägt
Plane die Woche in Zeitfenstern, nicht „am Rand des Kalenders“. Lege für die wichtigsten Aufgaben ruhige Blöcke fest (z. B. 2×120 Minuten), danach ein kurzes Zeitfenster für Durchsichten. Plane Wartezeit offen ein (z. B. „Rückmeldungen sammeln“), statt sie zu ignorieren. Am Ende jeder Woche ein 20‑Minuten‑Rückblick: Was hat länger gedauert – und warum? Was davon war absehbar? Was davon fließt ins Logbuch? So wächst aus jeder Woche ein Stück Außenperspektive.
Zahlen ohne Mathe‑Schreck: 50 Prozent und 80 Prozent
Die 50‑Prozent‑Schätzung (P50) ist die ehrliche Mitte: In etwa jede zweite Planung trifft. Die 80‑Prozent‑Schätzung (P80) ist die verlässliche Zusage: In vier von fünf Fällen passt sie. Du kannst P80 als „P50 plus Zuschlag“ verstehen – abgeleitet aus deiner Spanne zwischen optimistisch und pessimistisch. Beispiel: Du schätzt für einen Text 6 Stunden (optimistisch 4, pessimistisch 12). Deine Mitte liegt bei rund 7–8 Stunden. Für eine 80‑Prozent‑Zusage rechnest du einen Zuschlag dazu und kommunizierst 9–10 Stunden. Es geht nicht um Exaktheit, sondern um ehrliche Erwartungen.
Starte kostenlos mit meinen nützlichen Einsteigerkursen!
- Immer die passenden Worte finden und ausdruckstärker sprechen lernen in nur 5 Minuten täglich!
- Kinderleicht Interessenten gewinnen – die Threads App als Booster für deine Social-Media-Reichweite nutzen!
- Herausstechen und überzeugen – Mit der Journalisten-Methode gegen den KI-Content-Müll angehen!
- Deep Work für Selbstständige – mit Sprache und KI Produktivität verdoppeln und Arbeitszeit halbieren!
Sofort umsetzen – ohne neue Tools
Nimm dein nächstes Vorhaben und schreibe auf einer halben Seite: Ziel, warum es wichtig ist, was im schlimmsten Fall schiefgehen könnte und woran du das früh erkennst. Schätze dann drei Zeiten pro Hauptschritt (optimistisch / realistisch / pessimistisch). Markiere die 50‑Prozent‑Schätzung für dich; nach außen nennst du die 80‑Prozent‑Schätzung. Plane einmal pro Woche einen kurzen Realitätscheck: Was hat länger gedauert – und warum? Diese Erkenntnisse landen im Logbuch.
Wenn du Tempo brauchst, ändere die Art der Arbeit, nicht die Länge des Tages: diktieren statt tippen, Rohfassungen am Stück, Durchsichten in festen Zeitfenstern. Du sparst Zeit, weil du Kontextwechsel vermeidest. Baue dir für wiederkehrende Aufgaben kleine Bausteine (Vorlagen, Checklisten, feste Abläufe). So reduzierst du die Zahl der offenen Entscheidungen – und gewinnst Tempo ohne Qualitätsverlust.
Beispiel: 30 Blogbeiträge in 60 Tagen – der realistische Weg
Das Ziel klingt knackig. Die Innenperspektive sieht „täglich ein Beitrag“. Die Außenperspektive fragt: Wie viele Stunden in der Woche sind realistisch? Wie viele Durchsichten pro Beitrag? Welche Unterbrechungen sind unvermeidlich? Daraus entsteht ein Takt: zwei Beiträge pro Woche mit festen Durchsichten und ein Reserve‑Zeitfenster alle zehn Tage. Nach sechs Wochen stehen 12–14 gute Beiträge. Die restlichen folgen auf derselben Spur – oft schneller, weil Ton, Vorlagen und Abläufe stehen. Am Ende sind es 30 – nicht in 30 Tagen, sondern in 60. Realistisch schlägt heroisch.
Gespräche, wenn Termine zu eng sind
Verschiebe die Diskussion von Glauben zu Wahrscheinlichkeit: „Wir können bis zum 28. mit 50 Prozent Sicherheit liefern. Für 80 Prozent Sicherheit liegt der Termin am 4. des Folgemonats. Variante A: kleinerer Umfang bis zum früheren Datum. Variante B: voller Umfang zum späteren Datum. Was ist wichtiger?“ So wird Druck zur bewussten Entscheidung.
Ein zweites Szenario: „Wenn wir alles bis Monatsende liefern wollen, steigt das Risiko für Nacharbeiten. Alternative: Kernumfang bis Monatsende mit hoher Sicherheit, Rest in der darauffolgenden Phase. So schützen wir Qualität und Budget.“ Diese Sprache klingt nicht defensiv – sie ist verantwortungsvoll.
Häufige Einwände – kurz beantwortet
„Puffer wirken unprofessionell.“ Unprofessionell ist, Unsicherheit zu verstecken. Professionell ist, sie sichtbar zu machen und zu steuern.
„Unsere Kundschaft will fixe Daten.“ Kundschaft will Verlässlichkeit. Fixe Daten ohne Wahrscheinlichkeit führen zu enttäuschten Erwartungen. Bandbreiten schaffen Klarheit.
„Das Logbuch kostet Zeit.“ Zehn Minuten nach Abschluss reichen. Die Zeit holst du beim nächsten Projekt mehrfach wieder rein.
„Wir sind zu klein für so viel Prozess.“ Gerade kleine Teams gewinnen: weniger Leerlauf, weniger Stress, bessere Qualität.
Mein bisher wichtigstes Buch kannst du jetzt bei Amazon bestellen! Die „Journalisten-Methode“ ist ein einfaches und leicht im Arbeitsalltag anzuwendendes System, mit dem ich mich in Zeiten von KI-Content-Einheitsbrei behaupte und relevant bleibe – und das kannst du auch!

Fazit – Entscheidend ist, wie man mit dem Planungsfehler umgeht
Du bist nicht „schlecht im Planen“. Du bist ein Mensch mit deinen Stärken und Schwächen. Der Planungsfehler ist uns praktisch angeboren. Entscheidend ist, wie du damit umgehst: Außenperspektive statt Wunschbild, Vorab‑Fehleranalyse statt Schönrechnen, Bandbreiten statt Scheinpräzision. Plane in Zeitfenstern, zähle Reibung mit, sprich Erwartungen klar aus. So reduzierst du Stress, schützt die Qualität – und stärkst deine Verlässlichkeit. Den Planungsfehler zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren ist Übungssache – und das allein ist doch schon eine gute Nachricht, oder?
Wenn du mit mir arbeiten möchtest, empfehle ich dir mein Erstgespräch, in dem wir uns kennen lernen. Und wenn du intensiv mit mir arbeiten möchtest, starte mit mir zu mehr Klarheit und Momentum.

